War und
ist es das sinnfällige Demonstrieren von Machtansprüchen, der
funktionale Dienst an der Liturgie oder schlicht die Freude am Klangerlebnis,
dass die Orgel als das Kultinstrument des abendländisch-christlichen
Kulturkreises in unsere prächtigen Kirchenräume gelangte? Die
Kulturgeschichte der Orgel ist jedenfalls seit frühester Zeit eng
verknüpft mit der Geschichte der bedeutendsten Kathedralen, Klöster
und großen Stadtkirchen des Abendlandes. Die Orgel ist zwar nicht
in diese Räume hinein geboren, doch sie ist in ihnen gewissermaßen
aufgewachsen und „groß“ geworden. Für die Ausprägung der
westlichen Liturgie wurde das Instrument zentral und unverzichtbar und
entfaltete darüber hinaus durch die treffliche Kunst talentierter
Orgelspieler ein künstlerisches Eigenleben und schließlich eine
eigene grandiose Entwicklungsgeschichte.
Seit dem Mittelalter gibt es bedeutende
Orgelbauten und mit fortschreitender Zeit einen wachsenden Fundes an überlieferter
hochwertiger Orgelliteratur, die immer kunstvoller interpretiert wird.
Die Geschichte der Kirchenbaukunst und die Geschichte der Orgelmusik sind
innerhalb von fast 2000 Jahren Christentum zu einem durch die westliche
christliche Religionskultur getragenen Kulturgut verschmolzen, so dass
wir nun im 21. Jahrhundert in der Trias „Singuläres christliches Ideengut
– singuläre Sakralarchitektur – singuläre Orgelmusikkultur“ als
einen phänomenalen Schatz besitzen.
Vom „beglückenden“ Hören
Um Musik genussvoll sinnlich erfahren
zu können, muss ein bestimmtes Instrumentarium in einem ihm adäquat
bemessenen und gestalteten akustischen Raum (Klangrahmen) erklingen. Es
ist für jede musikalische Darbietung eine hermeneutische Kernfrage,
womit für welchen Kreis an Hörern in welcher Umgebung musiziert
wird. Eine Vielzahl an höchst komplexen physikalisch-akustischen,
aber auch soziologischen und psychologischen Parametern entscheidet einerseits
über
Klangentwicklung und Durchhörbarkeit (Transparenz), andererseits aber
auch über die Freude eines subjektiv als genussvoll empfundenen Hörerlebnisses.
Beglückendes Hören kann innerhalb
sehr unterschiedlicher Bedingungen erlebt werden. Geht es um das Musizieren
zur eigenen, ganz privaten Freude am häuslichen Clavichord, um die
Darbietung eines Streichquartetts in der Aula eines Gymnasiums etwa zur
Abiturfeier, um ein Kammerorchester im historischen Ratssaal einer Kleinstadt
oder das große, professionelle Sinfonieorchester in der großstädtischen
Philharmonie? Der jeweils ideale räumliche Rahmen für diese recht
unterschiedlichen musikalischen Darbietungen sieht jeweils ganz anders
aus.
Nun fehlt der großen Pfeifenorgel
weitgehend eine verbindliche Normierung, wie sie bei fast allen anderen
Musikinstrumenten existiert. Orgelklang und Orgelklang sind nicht – eigentlich
nie! – dasselbe. Auch Orgeln gleicher Größe und ähnlicher
Bauart können sich gleichwohl dramatisch in ihrem Klang unterscheiden,
während dies etwa für den Geigen-, Oboen- oder Klavierklang in
weitaus geringerem Maße gilt. Nicht jede instrumentale Ensemble-Besetzung
ist für jeden Raum günstig oder ratsam, wie auch nicht jedes
Orgeldispositions-Modell für jeden Raum das richtige ist. Ein und
dieselbe Disposition kann in dem einen Raum traumhaft berückende Klangwirkungen
ermöglichen, in einem anderen jedoch problematisch und unbefriedigende
Resultate erbringen.
Die Hörerfahrung wird physikalisch
geformt durch den Frequenz- und den Schallpegelbereich, durch die individuelle
Ausformung und die dynamische Charakteristik der Schallquelle, durch die
Größe des Raums und sein charakteristisches Absorptions- bzw.
Reflexionsverhalten. Dazu kommen weitere Aspekte wie die spezifische Bauart
und die Materialien der ihn bildenden Reflexionsflächen, Zahl und
Beschaffenheit der sekundären Einbauten – und nicht zuletzt die Zahl
der Hörer und deren Entfernung zur Schallquelle. Zwar gibt es eine
beachtliche Bandbreite an möglichen Gestaltungsvarianten. Geht es
aber um glückliche, stabile Verhältnisse, ist bei weitem nicht
alles Machbare auch gut und ratsam.
Ein Raum sucht „seine“ Orgel
Sofern es sich nicht gerade um ein
transportables Positiv oder eine Kleinorgel handelt, ist die Orgel als
„Immobilie“ per se unverrückbar in die Architektur des Innenraums
integriert und tritt allein ihrer Größe wegen in einen optischen
Dialog mit den Proportionen und der Gliederung der innenarchitektonischen
Gestaltungselemente des Aufstellungsraums – oft sogar als visueller Gegenpol
zum Altar. Der Orgelprospekt oder Orgelschrein kann vollständig in
die Raumarchitektur einbezogen oder im anderen Extrem ein eigenständiges
Gebilde ohne Bezug auf die ihn umgebende Gestaltung sein. Er kann sich
gestalterischen Belangen des Architekten vollständig unterordnen oder
ganz aus autonomen akustischen Erfordernissen heraus entwickelt sein, die
im Zusammenhang mit der Raumakustik vom Instrument selbst diktiert sind.1
Selten werden Raum und Orgel – was
eigentlich den Idealfall darstellen würde – gemeinsam geplant und
vom ersten Planungsbeginn an aufeinander abgestimmt. In aller Regel ist
der Raum als invariante Planungsgröße längst vorgegeben,
bevor ihm dann sekundär eine Orgel „angemessen“ wird. Mit der Planung
einer neuen Orgel entsteht eine essenzielle Verbindung von Raum und Instrument,
von Auge und Ohr, eine architektonische und akustische Symbiose, die aber
nur dann von stabiler Dauer sein wird, wenn sie in jedem Einzelaspekt ihrer
Beziehung zueinander „glücklich“ ist.
Der Raum ist bereits da und sucht (s)einen
(musikalischen) Partner. Worum geht es? Es geht wohl kaum darum, dass der
Architekt, der Orgelsachverständige, der Orgelbauer, der
Kirchenmusiker, der Pfarrer, der Kirchenvorstand oder Pfarrgemeinderat
etc. als Bauherr, sich selbst bzw. seinen Eitelkeiten ein Denkmal setzt,
obwohl es auch dies bekanntlich immer gegeben hat – und noch immer gibt;
wir alle kennen einschlägige Beispiele: Orgelneubauten als reines
Repräsentations- und Prestigeobjekt, als Statussymbol zur Demonstration
von Macht, Herrschaft, Finanzkraft und gesellschaftlichem Anspruch.
Geht es uns indessen um eine wirklich
auf Dauer befriedigende und tragfähige Verbindung von Raum und Orgel,
müssen alle persönlichen Eitelkeiten und aus einer wie auch immer
gearteten Mode geborenen Vorstellungen zurückstehen. Wir leben, Gott
sei Dank, unter den extrem toleranten Bedingungen eines heute schier grenzenlosen
Stilpluralismus, der nicht nur avantgardistische Klänge und Kompositionen
gelten lässt, sondern sich zugleich an den Werten längst vergangener,
zum Teil archaisch anmutender Stilepochen erfreuen und bilden kann. Die
Postmoderne darf heute erstmals in der rund tausendjährigen christlichen
Musikgeschichte weit zurück und ebenso nach vorn in die Zukunft schauen.
Diese beherzt doppelte Blickrichtung ist gleichfalls zentral für die
Lösung der augenblicklich gestellten Aufgabe eines gültig gestalteten
Raum-Klang-Ensembles.
Eine neue Orgel – für
wen, für was?
Im Regelfall entsteht ein Orgelneubau
zunächst noch immer für den musikalischen Dienst in der gottesdienstlichen
Liturgie, wo er vorab die Gemeinde oder einen oder mehrere Vokalsolisten
begleitet oder zu den freien und cantus firmus-gebundenen Vor- und Nachspielen
erklingt. Diese einfachen, klar strukturierten und abgrenzbaren Aufgaben
kann – zumal bei stetig schrumpfenden Gemeindezahlen – bereits ein Positiv
gut erfüllen; als Instrument für den festlich ausgeschmückten
größeren Gottesdienst und das anspruchsvolle Orgelkonzert taugt
es jedoch nicht mehr. Im ersten Blick auf das Wesen der Orgel sollte man
meinen, dass es eigentlich so eine Art Universalinstrument geben müsste,
das alle möglichen Bedürfnisse und stilistische Orgeltypen funktional
in sich vereinigt. Aber selbst dann, wenn in der groß dimensionierten
romantisch-sinfonischen Disposition auch etliche Register einer Barockorgel
vertreten sind, kann die einzelne Stimme, die dann „irgendwo“zwischen zahllosen
Pfeifenreihen positioniert ist, nie die charakteristische Präsenz
erreichen, die intime Direktheit entfalten, die eben ganz selbstverständlich
für ein wesentlich kompakter und übersichtlicher strukturiertes
Barockinstrument des 17. oder 18. Jahrhunderts ist.
Im Idealfall entsteht eine neue Orgel
und ihr musikalisches Konzept, also ihre Disposition, aus den örtlichen
Gegebenheiten heraus, mit den „Werkmaßen“ und der vorfindlichen akustischen
Charakteristik des Aufstellungsraums. Indem ich akzeptiere, die künftig
an einem bestimmten Ort erklingende Orgelliteratur dem Instrument entsprechend
spezifisch auszuwählen, oft auch bei manchem schmerzlichen persönlichen
Verzicht, kann jede neue Orgelgestaltung der ästhetischen Aussage
einer vorgegebenen innenarchitektonischen Struktur gerecht werden. Und
lässt diese am Ende im Extremfall etwa gar keinen „autonomen“ sichtbaren
Orgelkorpus zu, dann müsste sie eben im Boden versenkt werden (z.
B. das Chorpositiv der Klosterkirche Mönchsdeggingen). Der musikalische
Gewinn hierbei ist die Aufforderung, sich der Literatur zuzuwenden, an
die sonst gar nicht gedacht wird.
Der Orgelbauer wird in aller Regel
wohl nur recht unvollkommen nachvollziehen können, was es bedeutet,
Max Regers Symphonische Phantasie und Fuge in d-Moll (Inferno) als Spieler
im Studium unter viel Mühen und Schweiß hart erarbeitet zu haben,
um sie dann auf der eigenen Orgel mangels Klangmasse niemals aufführen
zu können. Eher leidet er darunter, Sweelincks Chromatische Fantasie
in d „gleichstufig“ interpretiert hören zu müssen. Welche paradiesische
Freude, wenn ein Organist heute in seinem Amtsbereich sowohl eine gute„mitteltönige“
wie eine „barocke“ als auch eine große romantische Orgel vorfindet.
An den meisten Orten muss jedoch mit
einer einzigen Orgel auskömmlich gearbeitet werden, und vielerorts
ist schlicht der Raum zu klein, um einer großen sinfonischen Orgel
ausreichend Grundfläche, Höhe und Weite für den orchestralen
Klang zu bieten.
|
Weniger
ist oftmals mehr
Immer wieder
bedarf es folglich ganz besonderer Anstrengungen und Überlegungen,
wenn die orgelbauliche Verantwortung erkannt und wahrgenommen wird und
es gelingt, Raum und Orgelinstrument in der richtigen Balance zusammenzuführen.
Die Zufriedenheit über ein Ergebnis setzt voraus, dass der nicht an
der Planung beteiligte Orgelspieler die musikalische Aussage des Instruments
(an-) erkennt, auch wenn es nicht nach seiner persönlichen Idealvorstellung
ausgestattet ist. Immer und überall können an jedem noch so begründeten
Orgelkonzept bekanntlich darüber hinausgehende Wünsche angebracht
werden: „…Hätte man nicht wenigstens noch dieses und jenes Register
bauen sollen …?“ Die Orgel lässt Normierungen, wie oben bereits gesagt,
aus gutem Grund nicht zu, und eine konkret realisierte, schlüssige
Disposition hätte potenziell stets auch noch ganz anders aussehen
können. Wie in einem schweizerischen Volkslied hört der erfahrene
Orgelbauer deshalb: „Was ich will, das hab’ ich nicht, was ich hab’, das
will ich nicht!“
Sehr viele Orgeln
gehen im Übrigen erst durch fortgesetzte Umbauten (musikalisch) zu
Grunde, die durch Blindheit und Nichterkennen der originären Konzeption
ausgelöst wurden. Andere Auslöser für Umbauten sind sich
aggressiv etablierende, per se intolerante Moden oder auch die verhängnisvolle
Fehleinschätzung akustischer Phänomene, wenn z. B. eine Orgel
in der Registerzahl erweitert wird, weil ihr Klang den Raum nicht füllt
und dabei von verantwortlichen Laien nicht bedacht wird, dass 50 Dezibel
plus 50 Dezibel eben nicht automatisch schon 100 Dezibel ergeben, sondern
nur häufig geringfügig mehr, bei gleichzeitig in Kauf genommener
Verschleierung des Klangbilds; im Extremfall können Hinzufügungen
bei der Pfeifenorgel klanglich sogar ein „Weniger“ bedeuten – auch dafür
gibt es unrühmliche Beispiele. Mit zusätzlichen Registern wird
die Zahl der Schattierungsmöglichkeiten vergrößert, allerdings
auch die Absorptionskraft des Pfeifenwerks, von unerwünschten Interferenzerscheinungen
einmal gar nicht zu reden.
Wie in der bildenden
Kunst sparsamer Einsatz von Gestaltungsmitteln eine Aussage verstärkt,
so kann auch der sparsame, mithin intelligente selektive Einsatz von Orgelregistern
die Charakteristik eines Instruments in besonderem Maße steigern.
Bei der Planung eines jeden neuen Orgelprojekts steht also die Verantwortung
im Raum, immer alles mitzubedenken, was heißen muss, die Orgelgröße
nicht blind dem Prestige und dem Geldbeutel des Sponsors anzupassen, sondern
ihrer künftigen räumlichen und akustischen Umgebung. Und es gibt
keinen Grund, sich angesichts des grenzenlosen Reichtums anspruchsvoller
europäischer Orgelliteratur im Einzelfall vor einer geringeren Registerzahl
und einem niedrigeren Winddruck zu fürchten.
Eine
Orgel für den Konzertsaal
Solange die große
romantische bzw. sinfonische Orgel noch nicht existierte, verlangte der
weite, für den großen Klang prädestinierte Raum einer stattlichen
Kathedrale geradezu nach ihr. Sie bietet in ihrer baulich-architektonischen
Weite und Vielfalt nachgerade jedem Orgeltyp einen angemessenen Ort: An
das Positiv muss man nahe herantreten, um es in seiner kammermusikalischen
Intimität deutlich wahrzunehmen; die Schwalbennest-Orgel an der zentralen
nördlichen Langhauswand wird durch die günstigen Reflexionen
der Gewölbe vom Volk und über die gegenüberliegende Langhauswand
auch bestens vom Orgelspieler gehört; die Chororgel beschallt ähnlich
partiell wie die Langhausorgel das Geschehen um den Altar im Hochchor,
und die große Hauptorgel auf der Westempore darf alle Kraft entwickeln,
um in jeden Winkel einer Kathedrale hineinzutönen etc.
Und die Orgel
im Konzertsaal? Die im Verlauf der Musikgeschichte einsetzende Autonomisierung
der Kirchenmusik und Orgelkultur ließ im Zuge der Verbürgerlichung
des Musikwesens und der damit verbundenen Säkularisation auch die
Orgel in den Konzertsaal einziehen. Den Reichtum und die Existenzkraft
von Kompositionen, die ganz klar aus dem christlichen Geist heraus für
die Liturgie geschaffen wurden, wollte man nicht mehr an den sakralen Raum
gebunden wissen. Weshalb aber ist in den meisten bekannten Fällen
der Orgelklang im Konzertsaal so wenig befriedigend und so wenig erwünscht?
Wie viele prächtig gestaltete Konzertinstrumente stehen weltweit in
den philharmonischen Sälen – reine Orgelkonzerte aber finden, wenigstens
in unseren Breitengraden, nach wie vor zum ganz überwiegenden Teil
in den Kirchen statt. In vielen Konzertsälen bilden die Orgelprospekte
seit Jahr und Tag lediglich die traurige Kulisse für allerlei kulturelle
Groß- und Galaveranstaltungen usw.
Aus meiner Sicht
liegt dieses Phänomen jedoch letztendlich in der unglücklichen
Begegnung von gewollter, trockener Konzertsaalakustik (akustische Studiobedingungen)
und maschinenartig präziser Einschwingung und Beendigung eines „sterilen“
Orgelplenums begründet. Oft ist es nur leid- und schmerzvoll zu ertragen,
im Konzertsaal die Übergänge von der Stille zum Orgelplenum und
genauso vom Tuttiklang zur Stille mitzuerleben. Die Präzision des
Einschwingvorgangs und des Ausschwingens eines großen Schallpegels
wird durch die spezifischen Ansprüche an die Konzertsaalakustik direkt
und ohne Streuung übermittelt. Es ist für das Auftreten des lautstarken
Schallpegels ein großer Unterschied, ob dieser durch ein einziges
Instrument mit statischer Tongebung, gespielt von einer einzigen Person,
oder durch den Apparat eines hundertköpfigen Orchesters mit je individueller
Tongebung evoziert wird. Gerade das Sich-Aufbauen eines Schallereignisses
ist für unser Gehör ein spektakuläres sinnliches Ereignis
in sich, über die Maßen zur Beurteilung der Klangqualität
entscheidend; denn das Gehör bzw. menschliche Gehirn erkennt im Zeitraum
einer einzigen Sekunde 16 zeitliche Abschnitte und behält diese zehn
Sekunden lang im humanen Wahrnehmungsgedächtnis (siehe Grafik).2
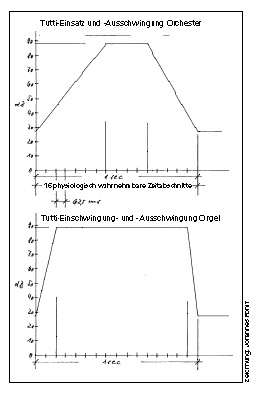 Die Konzertsaalakustik
ist für das Sinfonieorchester oder den großen sinfonischen Chor
gerade richtig, denn Orchester wie Chor schaffen allein durch die gesplittete
Art des Schallerzeugers in Bruchteilen einer Sekunde Übergänge
beim Aufbau einer großen Pegelzahl, die das Gehör nachvollziehen
kann. Das gelingt dem Gehör aber nicht beim Einsetzen eines Tuttiklangs
einer großen und lautstarken Orgel. Dieses Klangerlebnis, das in
einer Kirchenakustik mit gewisser Hallzeitgerade aufgrund der Präzision
und Statik des Klangs prächtig klingt, bleibt im Konzertsaal unbefriedigend
stumpf und steril.
Die Konzertsaalakustik
ist für das Sinfonieorchester oder den großen sinfonischen Chor
gerade richtig, denn Orchester wie Chor schaffen allein durch die gesplittete
Art des Schallerzeugers in Bruchteilen einer Sekunde Übergänge
beim Aufbau einer großen Pegelzahl, die das Gehör nachvollziehen
kann. Das gelingt dem Gehör aber nicht beim Einsetzen eines Tuttiklangs
einer großen und lautstarken Orgel. Dieses Klangerlebnis, das in
einer Kirchenakustik mit gewisser Hallzeitgerade aufgrund der Präzision
und Statik des Klangs prächtig klingt, bleibt im Konzertsaal unbefriedigend
stumpf und steril.
Die der Raumakustik
angemessene Konzertsaalorgel muss deshalb ein Instrument sein, das wie
ein Saiteninstrument, wie ein Klavier, wie ein Streichquartett kammermusikalisch
aus sich selbst heraus klingt, das des Raums zur Klangveredelung gar nicht
bedarf. Es muss niedrigen Winddruck haben, wie eine italienische Orgel,
und das Pfeifenwerk und die ganze technische Ausstattung der Orgel muss
von vornherein auf „Klingen“ eingestellt sein. Die Töne müssen
leicht und locker, angeregt durch einen Windhauch, aus dem Instrument mit
selbstverständlicher Gebärde herausfließen. Die besondere
Aufmerksamkeit bei der Planung und dem Bau des Instruments muss dem Pfeifenwerk
gelten. Auch das hochwertige Orchesterinstrument wird ja unter meisterlicher
Kontrolle gebaut. Jedes geringste Detail der Klangentstehung und des stationären
Klangs nimmt unser Gehör wahr und empfindet Genuss oder spontane Enttäuschung.
Dabei kann der Klang prächtig sein, darf aber in der Lautstärke
des Schalls sicher nicht die Pegelzahl des Kammerorchester-Tuttis überschreiten.
Für die
Existenz der kleineren Renaissance- oder Barockorgel im großen Konzertsaal
gibt es meines Wissens kein Beispiel. Wer endlich den Mut aufbringt, eine
hochwertige kammermusikalisch gestaltete Orgel im Konzertsaal mit seiner
„intimen“ Akustik zu bauen, in der man die sprichwörtliche Stecknadel
fallen hört, wird vom überzeugenden klanglichen Ergebnis überrascht
sein. Wir sehen, dass optische Orgelästhetik in die Leere führen
kann, denn bei einem Musikinstrument geht es primär um den bewussten
Umgang mit unserem Hör-Organ.
Johannes
Rohlf
1 vgl.
Thomas Lipsky: „Konzertsaalorgeln in Deutschland bis in die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts und ihre architektonische Einbindung in den Konzertsaal“
und Holger Brülls: „Der Orgelbau des 20. Jahrhunderts und die
Architekturdoktrin von Moderne und Postmoderne. Architekturhistorische
und planungstheoretische Überlegungen zum Verhältnis von Orgel
und Raum“, beide in: Acta Organologica, Band 28 (2004).
2 Ernst
Kern (Chirurg und Neurologe in Würzburg): „Rückkopplungsphänomene
zwischen Musiker und Musikinstrument“, in: Nova Acta Leopoldina 206, Band
37/1 (1972).
|